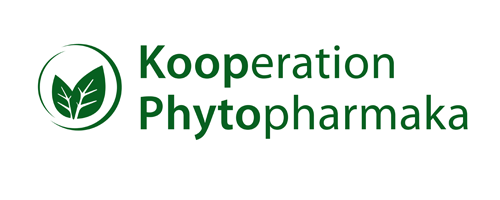Botanische Bezeichnung
Echtes Benediktenkraut, Bitterdistel – Centaurea benedicta (L.) L.
(Syn.: Cnicus benedictus L.)
Familie
Korbblütler (Asteraceae)
Wissenswertes zur Pflanze
Das Echte Benediktenkraut ist im östlichen Mittelmeergebiet und den angrenzenden Gebieten Asiens - Türkei bis Afghanistan - heimisch, in Mittel- und Westeuropa eingewandert. Vereinzelt wird es in Europa und in Nordamerika kultiviert. Es wächst an mäßig trockenen Ödlandstellen.
Der Gattungsnamen Centaurea leitet sich von gr. ‚kentaureios‘ (= zu den Kentauren gehörig), latinisiert zu ‚centaurus‘. Die Zentauren entstammen der griechischen Mythologie und sind Mischwesen aus Mensch und Pferd. Das Artepitheton benedictus kann mit „gesegnet, gepriesen“ (lat. ‚benedicere‘ = gut reden) übersetzt werden und beschreibt die vielgepriesenen Heilkräfte des Benediktenkrauts. Diese Deutung wurde auch in die deutsche Bezeichnung der Pflanze übernommen.
Das Benediktenkraut ist ein 10 bis 40 cm hoher distelartiger, einjähriger Korbblütler mit aufrechtem, verzweigtem Stängel. Die Blätter stehen wechselständig, sind schrotsägeförmig mit in Dornen auslaufendem Blattrand, zottig und drüsig behaart. Die gelben Blütenköpfchen stehen einzeln am Stängelende, mehrreihig von grünen, bestachelten, fiederteiligen Hüllblättern umgeben. Der Blütenboden ist seidig behaart und mit zahlreichen Spreublättern besetzt; darauf stehen die gelben Röhrenblüten. Blütezeit ist Juni/Juli.
Arzneilich verwendete Pflanzenteile (Droge)
Verwendet werden die während der Blütezeit geernteten, getrockneten oberirdischen Teile (Benediktenkraut, auch Kardobenediktenkraut – Cnici benedicti herba).
Die Droge des Handels stammt aus Wildsammlungen in Süd- und Osteuropa sowie aus Italien und Spanien.
Inhaltsstoffe der Droge
Benediktenkraut enthält Bitterstoffe vom Sesquiterpenlactontyp (Germacrantyp, u.a. Cnicin), Triterpene, Flavonoide und Lignanlactone.
Qualitätsbeschreibungen
Die Qualität des Benediktenkrauts (Cnici benedicti herba) ist im Deutschen Arzneimittel-Codex (DAC) festgelegt.
Medizinische Anwendung
Anerkannte medizinische Anwendung
Das HMPC hat Benediktenkraut als traditionelles Arzneimittel eingestuft (siehe „Traditionelle Anwendung“).
ESCOP: Benediktenkraut wurde bisher nicht bearbeitet.
Kommission E: bei Appetitlosigkeit und dyspeptischen Beschwerden.
Traditionelle Anwendung
Benediktenkraut wurde vom HMPC als traditionelles pflanzliches Arzneimittel (§ 39a AMG) eingestuft. Basierend auf langjähriger Erfahrung kann Benediktenkraut innerlich bei zeitweilig auftretender Appetitlosigkeit und zur Linderung von Verdauungsbeschwerden und bei krampfartigen Beschwerden im Magen-Darm-Bereich angewendet werden.
Arzneiliche Drogenzubereitungen in Fertigarzneimitteln
- geschnittenes Benediktenkraut zur Teebereitung
- Fluidextrakt in Tropfen
- wässrig-alkoholische Extrakte in Tropfen
Dosierung
Fertigarzneimittel: siehe Packungsbeilage;
Teeaufguss: 2- bis 3-mal täglich 1 Tasse ungesüßten Benediktenkrauttee 30 Minuten vor der Mahlzeit trinken oder bei auftretenden Beschwerden.
Bereitung eines Teeaufgusses
1,5 bis 2 g fein geschnittenes Benediktenkraut mit ca. 150 mL siedendem Wasser übergießen und nach 5 bis 10 Min. abseihen.
Hinweise
Bei bestehenden Allergien gegen Korbblütler (Asteraceae) sollte auf die Einnahme von Benediktenkraut verzichtet werden (Kreuzallergie möglich).
Für die Anwendung von Benediktenkraut während der Schwangerschaft und Stillzeit liegen noch keine Untersuchungen zur Unbedenklichkeit vor; von einer Anwendung bei Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren wird wegen mangelnder Erkenntnisse abgeraten.
Nebenwirkungen
Allergische Reaktionen möglich
Wechselwirkungen
Keine bekannt
Literaturhinweise
Drogenmonographien
HMPC (2024), Kommission E (1987)
Weiterführende Literatur
Wichtl: Teedrogen und Phytopharmaka
Schilcher: Leitfaden Phytotherapie
Van Wyk: Handbuch der Arzneipflanzen