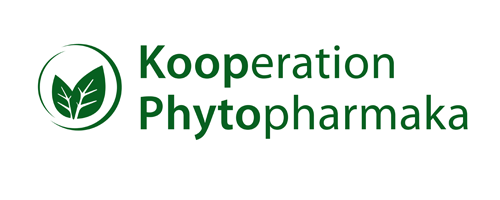Botanische Bezeichnung
Flohsamen-Wegerich, Flohkraut – Plantago afra L. [Syn. Psyllium afrum (L.) Mirb.]
Familie
Wegerichgewächse (Plantaginaceae)
Wissenswertes zur Pflanze
Der Flohsamen-Wegerich (Flohkraut) ist im Mittelmeergebiet (Südeuropa und Nordafrika) und im westlichen Asien beheimatet. Der Gattungsname Plantago, abgeleitet von lat. ‚planta’ (= Fußsohle, Fußfläche) mit dem bei Pflanzen häufigen Suffix ‚ago’, bezieht sich zum einen auf die flachen, eiförmigen in Rosetten eng am Boden liegenden Blätter des Breitwegerichs (P. major), zum anderen auch darauf, dass der Wegerich an den Wegen oft mit den Füßen niedergetreten wird. Das reichliche Vorkommen am Wegrand hat ihm auch den deutschen Namen „Wegerich“ eingebracht.
Der Flohsamen-Wegerich zeichnet sich allerdings durch kleine, sehr schmal-lineale Blätter aus. In den Blattachseln der oberen Blätter stehen die Blütenschäfte mit den kleinen Blüten in kurzen, dichtblütigen Ähren. Die Frucht reift zu einer zweifächrigen Deckelkapsel heran mit je zwei kleinen elliptischen, rotbraunen, glänzenden Samen. Diese erinnern an Flöhe, was der Pflanze den deutschen Namen „Flohkraut“ oder „Flohsamen-Wegerich“ eingebracht hat. Dies kommt auch im synonymen lateinischen Gattungsnamen der Pflanze (Psyllium) zum Ausdruck: lat. ‚psyllium’ (= Floh), was sich in der Drogenbezeichnung noch erhalten hat (Psyllii semen).
Arzneilich verwendete Pflanzenteile (Droge)
Verwendet werden die reifen, rotbraunen Samen (Flohsamen - Psyllii semen); in gleicher Weise werden auch die Samen von Plantago indica L, (Syn. P. psyllium L., P. arenaria Waldst.& Kit.) genutzt sowie die Indischen Flohsamen (Plantaginis ovatae semen) und deren Samenschalen (Plantaginis ovatae seminis tegumentum); die beiden letzteren Drogen stammen von P. ovata Forssk. (Syn. P. ispaghula Roxb.).
Inhaltsstoffe der Droge
Flohsamen/Indische Flohsamen enthalten in der Samenschale Schleimstoffe, im Endosperm fettes Öl.
Qualitätsbeschreibungen
Die Qualität folgender Drogen bzw. Drogenzubereitungen ist im Europäischen Arzneibuch (Ph. Eur.) festgelegt:
- Flohsamen (Psyllii semen)
- Indische Flohsamen (Plantaginis ovatae semen)
- Indische Flohsamenschalen (Plantaginis ovatae seminis tegumentum)
Medizinische Anwendung
Anerkannte medizinische Anwendung
Das HMPC hat die innerliche Anwendung von Flohsamen und Indischen Flohsamen bzw. Indischen Flohsamenschalen bei chronischer Verstopfung und zur Erweichung des Stuhls bei schmerzhaftem Stuhlgang nach rektalen oder analen Untersuchungen, bei Analfissuren und Hämorrhoiden, als „medizinisch anerkannt“ („well-established use“) akzeptiert. Für Indische Flohsamenschalen gilt zusätzlich als medizinisch anerkannt die innerliche Anwendung bei Patienten, deren tägliche Einnahme von faserreicher Kost erhöht werden muss, um ein Verstopfung-dominiertes Reizdarmsyndrom zu verbessern sowie zur Unterstützung der Behandlung einer Hypercholesterolämie.
ESCOP: Indische Flohsamen bzw. Flohsamenschalen: bei gelegentlich auftretender Verstopfung und wenn eine leichte Darmentleerung mit weichem Stuhl erwünscht ist (z.B. bei Analfissuren, Hämorrhoiden, nach rektalen Untersuchungen und in der Schwangerschaft); außerdem zur Erhöhung der täglichen Einnahme von faserreicher Kost – z.B. bei Reizdarmsyndrom - und unterstützend zur symptomatischen Behandlung unspezifischer Durchfälle. Für Indische Flohsamenschalen gilt als zusätzliches Anwendungsgebiet die Beigabe zu einer Niedrigfettdiät im Falle einer leichten oder mäßig starken Hypercholesterolämie.
Kommission E: Flohsamen: habituelle Obstipation (chronische Verstopfung); Colon irritabile (Reizdarmsyndrom). Indische Flohsamen/Indische Flohsamenschalen: Innerlich bei chronischer Verstopfung und bei Erkrankungen, bei denen eine erleichterte Darmentleerung mit weichem Stuhl erwünscht ist (Analfissuren, Hämorrhoiden, nach rektal-analen Eingriffen, während der Schwangerschaft); unterstützende Therapie bei Durchfällen verschiedener Ursache sowie bei Reizdarm.
Traditionelle Anwendung
entfällt
Arzneiliche Drogenzubereitungen in Fertigarzneimitteln
- ganze oder zerkleinerte Flohsamen
Dosierung
25 bis 40 g Flohsamen (Tagesdosis) in drei Einzeldosen mit reichlich Flüssigkeit einnehmen (sehr wichtig! mind. 200 mL pro Dosis). Flohsamen kann auch in Wasser, Milch oder Saft vorgequollen eingenommen werden. Während der Therapie mit Flohsamen muss in jedem Fall eine reichliche Flüssigkeitszufuhr gewährleistet sein.
Indische Flohsamenschalen: Da der quellfähige Schleim in der Samenschale liegt, haben pro Gewichtseinheit die Flohsamenschalen ein deutlich stärkeres Quellvermögen als die Samen. Deshalb genügen 7 bis 11 g Indische Flohsamenschalen (Tagesdosis) in drei Einzeldosen. Wichtig ist auch hier, dass reichlich Flüssigkeit nachgetrunken wird (mind. 200 mL pro Dosis).
Hinweise
Auf reichliche Flüssigkeitszufuhr ist zu achten!
Bei Verdacht auf Darmverschluss (Ileus), erkennbar an starken Unterleibsschmerzen mit Übelkeit und Erbrechen, bei Erkrankungen der Speiseröhre und bei Schluckbeschwerden sowie bei Stenosen des Magen-Darm-Trakts dürfen Flohsamen nicht eingenommen werden. Auch sollen Flohsamen nicht unmittelbar vor dem Schlafengehen eingenommen werden.
Von einer Anwendung bei Kindern unter 6 Jahren wird wegen mangelnder Erkenntnisse abgeraten.
Nebenwirkungen
Flohsamen enthalten Allergene, die bei der Einnahme und der Verarbeitung starke allergische Reaktionen wie Schnupfen, Bindehautentzündung, Bronchialspasmen oder allergische Hauterscheinungen auslösen können. Abgesehen davon sind bei Beachtung der erhöhten Flüssigkeitszufuhr keine Nebenwirkungen zu erwarten, allenfalls Blähungen.
Wechselwirkungen
Flohsamen/Flohsamenschalen sollen ½ bis 1 Stunde vor oder nach der Einnahme von anderen Arzneimitteln eingenommen werden, da sich ansonsten die Aufnahme anderer Arzneimittel aus dem Magen-Darm-Trakt verzögern kann.
Literaturhinweise
Drogenmonographien
HMPC (2013), ESCOP (2016, 2020), Kommission E (1990, 1991), WHO Vol. 1
Weiterführende Literatur
Wichtl: Teedrogen und Phytopharmaka
Schilcher: Leitfaden Phytotherapie
Van Wyk: Handbuch der Arzneipflanzen
Kommentar zum Europäischen Arzneibuch (Flohsamen, Nr. 0858, Indische Flohsamen, Nr. 1333, Indische Flohsamenschalen, Nr. 1334)